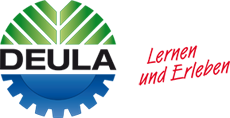Alte und gesunde Obstsorten, ein neuer Schwerpunkt für die LVGA
An unserem Standort Müncheberg, der Obstbau- Versuchsstation, und mit unserem Partner und Mitglied der LVGA , dem Pomologenverein, widmet sich die LVGA intensiv diesem Thema und bietet dazu vielfältige Schulungen an, z.B. zum Obstbaumwart. Details finden Sie HIER.
Anmeldung zum Jahrgang 2021 - 2022 HIER.

23. VOB-Tag an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. in Großbeeren
Am 25.02.2022 fand an der LVGA der 23. VOB-Tag in Form einer Onlineveranstaltung statt. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin-Brandenburg e.V., Herrn Hoch, folgten für die über 40 Teilnehmenden an ihren Bildschirmen, eine Abfolge von 5 spannenden Vorträgen, sowie einer zusammenfassenden Diskussionsrunde.
Unter dem Titel „VOB/A – Was ist neu ab 2022“, referierte RA Clemens Bober, FG Berlin und Brandenburg e.V. über die Neuregelungen im vergabeverfahren, die ab 2022 zu erwarten sind.
„Der Widerruf des Verbrauchervertrages – zur Entwicklung in der Rechtsprechung“, unter diesem Titel und anhand von aktuellen Rechtsprechungen, erörterte RA Jörn Lassan, FGL Berlin-Brandenburg e.V., Lösungen und Fallstricke im Umgang mit dem Widerruf von Verbraucherverträgen.
RA Dr. Andreas Schmidt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, SMNG Köln, erörterte in seinem Vortrag „Verträge bei steigenden Materialpreisen – Tipps & und Tricks“, den Umgang mit Materialpreissteigungen und gab Tipps und Tricks, wie diese Kosten an den Auftraggeber weitergegeben werden können.
„Keramische Beläge im GaLabau: Regelwerksvorgaben und Probleme aus der Praxis“, Herr Jörn Dahnke, ö.b.u.v. Sachverständiger im GaLabau, stellte in seinem Vortrag den Erfolg, die Chancen, aber auch die Risiken beim Einbau und der Verwendung von keramischen Wege-, Platz- und Terrassenplatten dar und referierte zu den Regelwerksvorgaben und den daraus entstehenden Problemen in der Praxis.
Über die „Neuregelungen in der ZTV Wegebau“ und deren Entwicklung, die Einordnung und den Anlass der Überarbeitung, sprach Prof. Martin Thieme-Hack, Sprecher des FLL-Regelwerksausschusses.
Ideen, Fragen und Fachdiskussionen im Austausch mit den Teilnehmenden rundeten den 23. VOB-Tag erfolgreich ab. Wir bedanken uns bei den Dozenten, den Teilnehmenden und den Mitwirkenden für diesen erfahrungsreichen und informativen Tag!

Forschungsprojekte rund um die Kirsche: Kirschseminar vom 3. Juli in der Obstbau-Versuchsstation (OBVS) Müncheberg
„SO stelle ich mir den idealen Seminarort vor!“ raunt mir meine Sitznachbarin zu. „Treffpunkt: Am Teich unter der Eiche“ hatte es auf der Einladung geheißen, das Wetter ist gut, im Hintergrund stehen gefüllte Kirschkörbe, derer man sich bedienen und hindurchnaschen darf. Rund 150 Teilnehmer von Jung bis Alt haben sich am Teich im Halbkreis auf Bänken niedergelassen.
Mit einem kurzen Willkommen eröffnete Holger Schulz, Leiter der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA), die Veranstaltung und übergab an Tobias Hahn, den Technischen Versuchsleiter der OBVS, welcher durch den Nachmittag leitete.
Nach seinem Bericht werden in Deutschland pro Kopf und Jahr durchschnittlich knapp 3 Kilo Kirschen verzehrt, davon kommt jedoch nur knapp die Hälfte aus Deutschland. Der überwiegende Teil wird aus Ländern wie der Türkei importiert, da diese über ein optimaleres Kirschklima und damit weniger Fäule in den Kirschen verfügen. Doch nicht erst im Sommer, bereits im Frühjahr, wenn Spätfröste Blüten und Knospen schädigen, sind in Deutschland die Erträge gefährdet. In Zukunft könnten auch an der OBVS unterschiedliche Frostschutzmaßnahmen getestet werden, z.B. indem bei drohendem Frost mit Nebelgeräten die Wärmeabstrahlung aus der Obstanlage verringert oder der Anlage mit Hilfe von Mikrosprinklern Energie zugeführt wird.
Ulrike Holz vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF, Abteilung Pflanzenschutz) berichtete beispielhaft über Kirschfrucht- und Kirschessigfliege. Da diese bestimmte Witterungsbedingungen bevorzugen und verschiedene Reifestadien der Kirschen und anderer Früchte - bis hin zu Mini-Kiwis - befallen, hilft hier bereits eine überlegte Sortenwahl im Anbau, um Schäden zu reduzieren. Gelbtafeln mit Klebstoff eignen sich zwar nicht zum Reduzieren der Insekten, zeigen aber an, wann diese besonders aktiv sind. Da gerade die Kirschessigfliege im Jahr bis zu 20 Generationen produzieren kann, rät die Referentin, befallenes Obst abzusammeln und z.B. zu verjauchen, um Folgegenerationen zu zerstören. Für die vor erst rund 20 Jahren eingewanderte Amerikanische Kirschfruchtfliege dagegen gibt es weltweit große Forschungsprojekte auf der Suche nach dem optimalen natürlichen Gegenspieler.
Im anschließenden Vortrag von Jakob Kunzelmann (OBVS) ging es um die Verschiebung von Blütezeitpunkten aufgrund klimatischer Veränderungen. Bereits jetzt blüht die Kirsche rund eine Woche früher als noch vor 100 Jahren. W
erden die gesteckten Klimaschutzziele erreicht, prognostiziert man für den Zeitraum 2071-2100 eine weitere Verschiebung um 12 Tage. Bei einem „Weiter wie bisher!“ könnte sich der Blütezeitraum bis zu 39 weitere Tage vorverlegen. Er rät, bei Neuanpflanzungen gezielt spätblühende und frostfeste Sorten zu setzen.
Bei einem Rundgang durch die Obstanlagen ließen sich unterschiedliche Schnitt- und Baumformen begutachten; Tobias Hahn berichtete von verschiedenen Ansätzen in der Bodenpflege. Optimal erscheint derzeit, die Reihen direkt
unter den Bäumen (Baumstreifen) freizuhalten (weniger Nährstoffkonkurrenz, Mäuse können durch Jagdvögel gesichtet werden) und die zwischenliegende Fahrgassezwecks Befahrbarkeit zu mulchen, während die verbleibenden für Insekten blühen dürfen. Stare werden mittels Jagdvogel-Rufen aus Lautsprechern und drapierten Vogelattrappen erfolgreich von den Früchten ferngehalten.
Dr. Nathalie Soethe von der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) untersucht im Labor die Anfälligkeit von Nähstoffmangelgestressten Kirschen auf Pseudomonaden. In den Freilandanlagen der OBVS folgt der Test zur Wirksamkeit von Kupfer, Auxin (einem Wuchsstoff) sowie einem Hefepilz gegen Pseudomonaden. Pseudomonas ist ein Bakterium, welches Steinobst schädigt und im Extremfall bis zum Absterben der Pflanzen führen kann. Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und ist auf 3 Jahre ausgelegt; darauf aufbauende Folgeprojekte sind anvisiert. Da Pseudomonaden besonders gut unter feuchten Bedingungen gedeihen, schilderte Tobias Hahn, wie mittels Unterkronenbewässerung und Bodenfeuchtefühlern bis in 50 cm Tiefe möglichst genau die Bewässerungsmenge und -tiefe gesteuert und optimiert werden kann.
Die Reduktion des Wasserverbrauchs mittels Windreduktion durch Hecken untersucht Dr. Maik Veste vom Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. (CEBra e.V.) Ursprünglich für Zitrusplantagen in Südafrika geplant, wird dieses Forschungsprojekt aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen in Teilen in der OBVS durchgeführt. Erste Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass mit Hilfe von Windschutzpflanzungen bis zu 25% weniger Wasser zur Bewässerung benötigt würden. In Afrika hätte eine Reduktion des Windes wohl noch größere Effekte, nicht nur hinsichtlich des Wasserbedarfs, auch in Bezug auf Bodenerosion. Ganz unmittelbar sind dort zudem die Effekte wirtschaftlicher Art für den Zitrusbauern: Früchte, die ruhig hängend reifen und nicht in der Pflanze scheuern, entwickeln eine idealschöne Schale und lassen sich nachweislich zu einem zehnfach höheren Preis verkaufen.
So angefüllt mit neuem Wissen zogen Gäste und Veranstalter zurück und ließen den Nachmittag bei Kirschen und Getränken plaudernd auf einer Wiese unter Kirschbäumen ausklingen.
Von Maria Bach
Aprikosenseminar vom 20. Juli in der Obstbau-Versuchsstation (OBVS) Müncheberg
“Clarina” muss ans Westspalier!“

Wir sind beim Aprikosenseminar der LVGA auf der Obst- und Versuchsanlage in Müncheberg, der Referent Dr. Hilmar Schwärzel führt routiniert durch den Nachmittag des 20. Juli. Während sich am Vormittag Erwerbsobstbauern trafen, war der Nachmittag interessierten Hobbygärtnern gewidmet. Wieder haben sich zahlreiche Gäste eingefunden, die Sonne scheint und wie schon beim Kirschseminar vor wenigen Wochen ist auch diesmal der Ort schön gewählt und gut vorbereitet: Bänke im Halbrund zwischen Obstgehölzen, hinter dem Redner eine kleine Galerie von Myrobylane bis Marille und für die Gäste warten bereitgestellt die Körbe, um sich beim anschließenden Rundgang die reifsten und schönsten Früchte mit nach Hause zu nehmen.
Unterhaltsam schlägt Dr. Schwärzel den Bogen von der Geschichte ins Heute, beginnt mit der Magdalenenflut i.J. 1342 und ihren Folgen (Bodenerosion, Hungersnöte, Pest), der Ankunft der Aprikosen aus Armenien vor 800 Jahren und berichtet dann vom Ausbruch des Fagradalsfjall-Vulkans auf Island im Frühjahr dieses Jahres. Die Asche in der Atmosphäre verdunkelte die Sonne und Europa erlebte dies Jahr besonders späte Nachtfröste bis in den Juni hinein. All dies hat Auswirkungen auf den Obstanbau. Er legt den Gästen sehr ans Herz, sich als Multiplikatoren zu verstehen und als solche zu wirken, also nach dem Genuss der Aprikosen deren Kerne als Saatgut zu verwenden. DIES sei doch das eigentlich Wichtige! Bildreich und gut verständlich erläutert er den Weg des Kerns zum innerhalb drei Jahren fruchtenden Bäumchen, beginnend beim anfänglichen Lagern im Schuhkarton unterm Bett übers Gemüsefach im Kühlschrank bis hin zum Pflänzchen mit 120 Nodien schon im Herbst des ersten Jahres.
Beim späteren Gang durch die Obstanlage stehen die verschiedenen Aprikosensorten im Mittelpunkt: Ihre Wuchseigenschaften, Anfälligkeiten oder Vorzüge, vor allem auch Geschmack, Reifezeitpunkt und Größe. Schnell füllen sich die Körbe der Gäste mit den herrlichen Früchten.
Wir haben wieder viel gelernt, ‚Luizet‘, ‚Robada‘ und ‚Kioto‘ gegessen und gesammelt, Tipps und Tricks zum Stratifizieren, Okulieren und Veredeln erfahren und wissen nun auch, um Bodenmüdigkeit vorzubeugen gehört im heimischen Garten „immer zum Totensonntag eine Schubkarre Kompost an den Baum“!
Von Maria Bach
Evaluierung der Überbetrieblichen Ausbildung
Hospitation der ÜA – Kurse im GaLa-Bau an der LVGA in Großbeeren
Von Januar bis März vergangenen Jahres führte die LVGA eine Evaluierung der ÜA – Kurse durch, bei der alle Auszubildenden im zweiten und dritten Lehrjahr, sowie Ausbildungsbetriebe und auch die Ausbilder der LVGA mit Hilfe eines digitalen Fragebogens zu den Kursen befragt wurden. Die Auswertungen dazu liegen bereits vor und können unter dem unten beigefügten Link eingesehen werden.
Seit Anfang dieses Jahres werden nun auch im Rahmen der Evaluation sämtliche Kurse durch Vertreter des FGL – Bildungsausschusses, der öffentlichen Ausbildungsbetriebe und der Gewerkschaft IG BAU hospitiert. Anhand eines standardisierten Fragebogens werden somit die Rahmenbedingungen der Kurse (u.a. Gelände, materielle Ausstattung der Kurse, Kursstärke, Mittagessen), als auch die kursspezifischen Bedingungen (u.a. Praxisanteil, Pflanzenkunde, Bewertung der Baustellen) durch das Hospitationsteam unter die Lupe genommen und bewertet.
Frau Karina Martini, die bereits schon mehrmals als Hospitantin dabei war, äußerte sich nach ihrer letzten Hospitation: „Als Ausbilderin vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hospitierte ich an Kursangeboten der überbetrieblichen Ausbildung, um mit kritischem Blick und konstruktiven Vorschlägen zur Verbesserung der Kurse beizutragen.
In meinen Augen gilt es, den Schwerpunkt auf praktische Übungen zu legen und die Festigkeit der beruflichen Fertigkeiten zu erhöhen. Dabei wünsche ich mir kurze Korrekturen durch die Praxisanleiter/innen und mehr Zeit zum Üben.“
Für die LVGA und die daran beteiligten Mitarbeitenden sind dies wertvolle Aussagen, um die Qualität der Kurse weiter zu verbessern. Die Hospitationsphase wird sich auf Grund der zeitlichen Lage der Kurse bis in den Oktober 2021 erstrecken. Anschließend werden die Ergebnisse durch die Leiter des Hospitationsteams, Herrn Mehlitz und Herrn Hofmeister, zusammengefasst, als Bericht erstellt und veröffentlicht.
Auch Herr Matthias Lösch (Fa. Roland Riedel und Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V. war bereits mehrmals als Hospitant tätig und äußerte sich zu der Evaluation: „Die überbetriebliche Ausbildung ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Baustein in der Dualen Ausbildung des Gärtnerberufes. Die Evaluierung zeigt deutlich, dass an unserem Standort in Großbeeren (LVGA) diese Arbeit mit viel Engagement und Kompetenz geleistet wird. Für diesen Qualitätsbaustein werden wir von vielen Branchen beneidet.“
An dieser Stelle danken wir allen Hospitanten für ihren engagierten Einsatz und freuen uns auf weitere Anregungen.
"Folgend finden Sie die Auswertungen zur Evaluation und Hospitation zum Download."
- Auswertung Evaluierung ÜA 2020 - Stand 2020 September (Bericht zum Download)
- Auswertung Hospitation ÜA 2021 (Bericht zum Download)